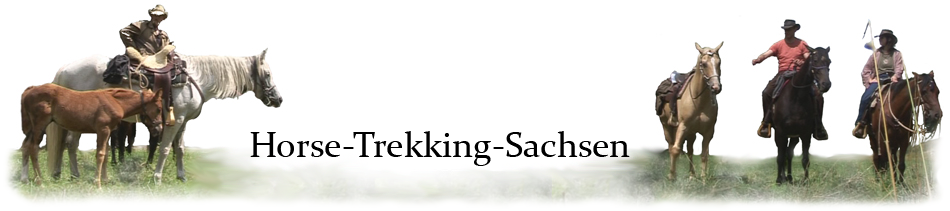
Anpassung und Relativität (2015)
In einer Fachzeitschrift erschien vor geraumer Zeit ein Artikel mit dem Grundtenor: »Die unterschätzte Vorderhand«.
In der Folgezeit erlebte ich etliche Dispute zu diesem Thema. Vor allem von Anhängern schneller Sportarten und besonders leistungssportlicher Pferdenutzung wurde der Beitrag positiv aufgenommen und Diskussionen endeten dann auch immer wieder in der ebenfalls aus dem Magazin stammenden Argumentation, das Pferd hätte, im Gegensatz etwa zu uns, schon fünfzig Mio. Jahre Zeit gehabt, seinen Bewegungsapparat zu entwickeln. Deshalb sei sein Organismus auch bestens für eine schnellste Bewegung gerüstet, und es würde wohl schon ausgestorben sein, wäre seine Vorderhand so anfällig, wie so oft in der konventionellen Reitlehre behauptet.
An der Argumentation mit der langen Anpassung ist durchaus etwas dran, sagt aber noch nichts aus. Der Verlauf der Gespräche beweist allerdings einmal mehr, dass es selbst alte Reitsporthasen oft nicht schaffen, sich in der Beurteilung evolutionärer Mechanismen von vermenschlichtem Denken zu verabschieden.
Worauf kam es denn im täglichen Daseinskampf eines Wildpferdes in den letzten Jahrmillionen an? So schnell wie möglich zu sein? Sicher nicht, denn dann würde es inzwischen vielleicht weit über Tempo Hundertfünfzig erreichen.
Nein, für das Fluchttier kommt es vor allem darauf an, nur schneller, bzw. ausdauernder als sein Fressfeind zu sein und vor allem früh genug, d. h. bei noch ausreichendem Abstand zu diesem in Bewegung. Darauf war die Entwicklung seiner Anatomie ausgerichtet und alle Mechanismen abgestimmt.
Beschauen wir uns mal ein anderes Fluchttier, das seine Heimat genau wie das Pferd in Amerika hat.
Der Gabelbock ist die einzige Antilopenart der neuen Welt, existiert in mehreren Unterarten und erreicht etwa die Größe unserer europäischen Rehe. Zu seinen Besonderheiten gehört, daß er wohl der einzige Hornträger ist, der jährlich die Zierde seines Hauptes verliert und, ähnlich der Hirschartigen, wieder neu entwickelt. Mit denen hat die Gabelantilope allerdings nichts zu tun. Die Unterscheidung ist denkbar einfach. Während das Geweih der Hirsche aus Knochensubstanz besteht, handelt es sich bei den Haupteswaffen des Gabelbocks um Horn, also um ein Hautprodukt.
Interessant für unser Thema ist jedoch die Geschwindigkeit, die dieser paarhufige Steppenrenner erreichen kann. Es wurde schon Tempo 97 km/h gemessen.
Nun drängt sich die Frage auf, wozu eine solche Sprintfähigkeit, wo es doch weit und breit keinen Fressfeind gibt, der dieses Tempo auch nur annähernd erreichen könnte? Die Evolution funktioniert allerdings nicht erst, seit der Mensch die amerikanische Bühne betrat und alles durcheinander brachte.
Mit seiner Ankunft verschwand der Hauptfressfeind der Gabelantilope, der amerikanische Gepard. Wie schnell der laufen konnte, ist damals nicht gemessen worden, aber sein Körperbau gibt einigen Aufschluss. Er war größer als der rezente afrikanische/asiatische Verwandte, wies aber alle anderen Merkmale dessen auf, und es ist deshalb anzunehmen, dass er ihm in der Geschwindigkeit wohl kaum nachstand.
Allerdings ergaben sich daraus auch die gleichen Nachteile, die in geringer Ausdauer, niedriger Wehrhaftigkeit gegenüber stärkeren Nahrungskonkurrenten usw. erkennbar sind. Wenn er wohl, wie auch sein Altweltverwandter schneller als alle seine Beutetiere (auch die Gabelantilope) gewesen sein dürfte, so hatten diese jedenfalls eine größere Ausdauer und er nur dann die Chance auf einen Jagderfolg, wenn er so nahe an seine Opfer herankam, dass er sie einholen konnte, bevor ihm die Puste ausging.
Das überleben des Gabelbocks begründet sich also nicht nur auf seine Schnelligkeit, sondern auch auf Ausdauer, Wachsamkeit und vor allem auf das Herdenleben.
Selbiges gilt natürlich auch für das Pferd. Der amerikanische Gepard war für dies allerdings keine Gefahr, allenfalls für ein Fohlen, das aber gegen solche Jäger von der Mutter sicher vehement verteidigt wurde.
So lebten alle drei Arten einträchtig im gleichen Lebensraum. Der Gepard war das einzige Raubtier, das schnell genug gewesen sein dürfte, um mehr als einen Gelegenheitserfolg beim Gabelbock zu erzielen, der wiederum zu schnell war für die anderen Großraubtiere und zu ausdauernd, um auch von seinem Hauptgegner ernsthaft dezimiert zu werden.
Gleichzeitig war das zwar langsamere Pferd (60 70 km/h) zu groß und zu wehrhaft für den Gepard. Die Räuber (Amerikanischer Löwe, Kurznasenbär usw.), die groß und stark genug waren, um ein Pferd überwältigen zu können, standen zu ihm in einem ähnlichen Laufleistungsverhältnis, wie der Gepard zum Gabelbock. Sie waren ausdauernder als der Gepard und das Pferd ausdauernder als sie. Das verdankt es übrigens vor allem seiner Fähigkeit zu schwitzen.
Wirklich zu Ende ging es auf dem Amerikanischen Kontinent mit Löwen, Geparden, Kalifornischen Panther, Kurznasenbären und Pferden erst nach dem Erscheinen des Menschen vor ca. dreizehn- bis zehntausend Jahren (Jungsteinzeit).
Zu diesem Zeitpunkt hatte die aus dem Pliohippus entstandenen Equiden allerdings bereits die gesamte alte Welt mit mehreren Arten für sich erobert.
Es ist umstritten, ob Menschen für das Verschwinden des Pferdes in Amerika verantwortlich waren. Fest steht allerdings, dass es in einigen Teilen der nördlichen Hemisphäre Stämme gab, die auf Pferdejagd spezialisiert waren. Dabei war es eine ihrer Hauptmethoden, ganze Herden in Abgründe zu treiben und sich die natürliche Konzipierung des Pferdes als Fluchttier zu Nutze zu machen.
Das war das Ende der selektiven Jagd.
Ein anderes Raubtier als der Mensch visiert in seinen Strategien einzelne und vor allem die schwächsten Tiere an, bzw. solche, die sich einzeln am Rand oder außerhalb der Herde befinden. Diese sind zudem vor allem männlich, und so bleibt (bei natürlichen Jagdweisen) die Basis für die Arterhaltung, nämlich die Mutterschaft und die Nachzucht, für die Regeneration der Population weitestgehend unbehelligt.
Das hat sich mit dem Streben des Menschen nach soviel Besitz wie möglich mit leider verheerenden Folgen verändert. Natur strebt stets nur nach soviel wie nötig.
In evolutionären Zeiträumen gerechnet existiert nun der Mensch allerdings erst einen Wimpernschlag lang. Da ist es dann kein Wunder, dass seine naturfremden Jagdmethoden in den Abwehrstrategien der Natur noch keine Berücksichtigung finden konnten, um die Ausrottung einiger Arten oder Populationen zu verhindern. Hier kann sich nur etwas positiv verändern, wenn sich in unserem Kopf und dann in unserem Verhalten etwas entwickelt.
Tiere sind jedenfalls ausschließlich auf die alten (sprich natürlichen) Jagdstrategien eingestellt. Da heißt das Prinzip eben auch: soviel wie nötig, nicht soviel wie möglich,
also Optimum, statt einseitigem Maximum.
Unter einem Optimum verstehe ich eine Kombination von gesunden Kompromissen, die in ihrer Gesamtheit einer hohen Anzahl verschiedener Erfordernisse im Leben eines Individuums Rechnung trägt.
Was bedeutet dies nun bezogen auf das Pferd?
Der Hauptschutz besteht vor allem im Zusammenwirken aller Abwehrmechanismen.
Die zielen zuallererst auf eine Früherkennung von Gefahren, um extreme körperliche Schutzaktivitäten gar nicht erst anwenden zu müssen. Dieses ist besonders gegeben durch die Funktionskreise, wobei sich die vorwiegend im Außenkreis befindenden männlichen Individuen als Frühwarner, bzw. als Ablenk- oder Kanonenfutter fungieren.
Ferner gibt es ein gut funktionierendes Wachhabendensystem, in welchem letztlich alle erwachsenen Stuten im Innenkreis (Kernzone) alternierend beteiligt sind.
Sollte es doch zu einer notwendigen Flucht kommen, so garantiert die klare Rangfolge, dass es gerade in dieser Situation, wo es darauf ankommt, geordnet zugeht, und zwar bis ins letzte Glied der Formation. Eine solche Herde ist in ihrer Gesamtheit zu einem Tempo bis zu 60 km/h fähig, ohne dabei die Bewegungsfolge des anatomisch günstigen Dreitaktes zu verlassen. Die Gruppe hält dies auch länger als jeder einzelne ihrer Jäger durch.
Deshalb waren auch hier, wie noch heute gut in den Savannen Afrikas zu beobachten, nicht die großen starken Katzen, oder die schnellsten die erfolgreichsten, sondern die Rudeljäger, die, sich gegenseitig ablösend, Wild über große Strecken hetzen konnten.
Die Statistik von Beobachtungen sagt folgendes aus:
Geparden brauchen durchschnittlich 10 Jagdzüge bis endlich einer erfolgreich abgeschlossen werden kann, was jedoch noch immer nicht bedeuten muss, dass er die Früchte seiner Mühen auch genießen kann. Zu viele möchten diese ihm gerne abjagen. Also bleibt ihm nur, die Beute vor Löwen, Leoparden, Hyänen usw. zu verstecken. Seine Erfolgsquote liegt also bei maximal 10%:
Bei den Löwen ist sie zwischen 30 und 50% anzusiedeln maximal. Dabei sind Löwen im Ngorongorokrater besser dran als die der offenen Savanne, da sie sich das ganze Jahr über in unmittelbarer Nähe zu ihren Beutetieren befinden, die ja ebenfalls wie sie das begrenzte Areal nicht verlassen müssen, denn deren Futter ist nicht saisonal schwankend. Außerhalb des Kraters hat es der »King« da wesentlich schwerer.
über die Erfolgsquote des Leoparden lässt sich weniger sagen, bestenfalls spekulieren, da sich seine Jagdmethoden sehr von denen anderer Jäger unterscheiden. Zudem lässt er sich dabei kaum in die Karten gucken, da er als absoluter Einzelgänger und vor allem vorwiegend in dunkelster Nacht unterwegs ist. Immerhin hat man diese gefleckte Katze dabei ertappt, wie sie, die Zugrichtung einer Antilopenherde vorausahnend, auf einen Baum kletterte und sich, als sich die Beute unmittelbar unter ihr befand, einfach vom Ast auf sie fallen ließ.
Die eindeutigen Sieger der Statistik sind jedoch die afrikanischen Wildhunde, bei denen aufgrund ihrer Rudelstrategie fast jeder Jagdzug erfolgreich abgeschlossen werden kann Quote: 95 100%.
Interessant ist dabei natürlich der Vergleich zu den Löwen, die im Rudel leben und je nach anvisierter Beute allein, zu zweit, oder im Rudel jagen. Ihre Fähigkeit, Wild zu hetzen, ist im Gegensatz zu den Wildhunden sehr begrenzt. Das gleichen sie allerdings dadurch aus, dass sie sich mit der geballten Kampfkraft des Rudels, wenn nötig einschließlich der männlichen Tiere, an wirklich großes wehrhaftes Wild heranwagen können, vom Kaffernbüffel bis zu großen Elefanten. Die kommen kaum als Beute für die Hunde in Frage, selbst mit der nicht seltenen Rudelstärke von 50 und mehr Individuen.
So, oder ähnlich derer, wie wir sie in den heutigen halboffenen oder offenen Landschaften Afrikas noch vorfinden können, dürfen wir uns auch die Verhältnisse in den Prärien Nordamerikas vorstellen, auf die dort einst die ersten Menschen stießen.
So waren sie in den Steppen des südlichen und östlichen Europas, sowie Innerasiens, sogar noch in der Zeit nach Christus, als in diesen Gebieten noch neben dem mächtigen Wisent, dem Pferd, den Halbeseln, der pfeilschnellen Saigaantilope, wie auch dem wehrhaften Auerochsen noch die dazugehörigen Jäger wie Kaspischer Tiger, Eurasischer Löwe, Gepard, Leopard und die Wölfe der nördlichen Hemisphäre existierten.
All diese Jägern haben dabei ein ähnlicher Bau ihrer Körper für die Jagd gemeinsam. Das sind vor allem bei den Katzen eine sehr biegsame und elastische Wirbelsäule, die sich im Spurt wie eine Feder aufziehen und strecken lässt, aber auch einen überfall im Catcher-Stil ermöglicht. Das betrifft auch die Pranken, mit deren Schlag man dem Opfer die Beine unter dem dahin schnellenden Leib gewissermaßen wegwischen und es so zu Fall bringen kann. Besonders aber sind bei all diesen Räubern die Karpalgelenke so elastisch gebaut, dass der Viertaktgalopp in höchster Geschwindigkeit auch bei Dauerbelastung keinen Schaden erzeugen kann.
Nun stellt sich daraus die Grundfrage, wegen derer ich dies alles so ausführlich behandle:
Wenn dieser Bauplan günstiger ist für diese Bewegung, warum sind dann nicht auch die Beine des Pferdes ebenso gebaut?
- Alle überlebensmechanismen des Pferdes sind darauf ausgerichtet, dass es gar nicht erst soweit kommt, dass es einen Fluchtgalopp im Maximaltempo nötig hat.
- Eine Katze, oder ein Wildhund vermag sich zu ducken, um sich zu verbergen, zu kriechen, oder zu schleichen, während das Pferd im Gegensatz dazu immer versucht, den überblick wie auch die Fluchtbereitschaft beizubehalten.
- Equiden haben von der Ruhestellung bis zur vollen Fluchtbereitschaft den kürzesten Weg aller Huftiere, denn es kann im Stehen schlafen, und das ist auch nur bei diesem Bau seiner Gelenke (auch des Karpalgelenkes) möglich. Da haben wir es wieder das Optimum (bestens ausgerüstet durch Kombinationen von Kompromissen für mehrere verschiedene Funktionen). Aufrecht schlafen kann keiner der Fressfeinde der Equiden.
- Ein Jäger geht Maximaltempo bei nahezu jeder Verfolgungsjagd mindestens im Schlussspurt, d. h. mehrmals am Tag (Gepard bis zu 10 mal). Ein Pferd hat dieses in einer funktionierenden Natur vielleicht ein bis zweimal im Jahr, aber eher seltener - zwei bis dreimal in seinem Leben nötig.
So ist jedes dieser Tiere von der Natur ausgestattet für die Erfordernisse, die seine Lebensumstände ihm aufbürden. Das Pferd ist aber auf jeden Fall nicht von der Schöpfung dafür vorgesehen, unsere Last zu tragen. Bürden wir sie ihm trotzdem auf, so sind wir auch dazu verpflichtet, dies so zu tun, dass es nicht zu seinem Schaden gereicht.
R.K.
Artgerechte Haltung - was ist das? (2010)
Auch auf die Gefahr hin mich mit unpopulären äußerungen unbeliebt zu machen, muss ich eines gleich vorweg nehmen:
Kein Tier hat eine Vorstellung von Freiheit
Das Wort Freiheit ist ein rein menschlicher Begriff, oder vielmehr eine philosophische Kategorie, für ein Tier nicht fassbar. Deshalb benutze ich auch nicht gern Begriffe wie »in Freiheit« oder »Gefangenschaft«, sondern spreche lieber von der Natur, beziehungsweise dem Tier in menschlicher Obhut.
Gleichwohl hat das Tier Prämissen, deren Erfüllung oder Nichterfüllung dafür steht, ob das Tier sich wohl fühlt und gedeiht (sowohl physisch als auch psychisch), oder dies eben nicht tut und mehr in oder weniger starkem Maß leidet oder gar Schaden nimmt.
Bis vor etwa 70 Jahren war das Pferd zu aller erst ein militärisches Objekt und den dementsprechenden Notwendigkeiten unterworfen. Noch im zweiten Weltkrieg waren allein auf der deutschen Seite noch zwei Mio. Militärpferde im Einsatz. Die wenigsten von ihnen überlebten den Wahnsinn.
Auch im Bereich seiner zivilen Einsatzgebiete dauerte es nach dem Krieg nicht länger als etwa zwei Jahrzehnte bis auch dort die Pferde durch Motorfahrzeuge ersetzt wurden.
Entweder musste es sterben, oder sich ein anderes Einsatzgebiet für dieses Tier ergeben, das so maßgeblich wie kein anderes an der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft beteiligt war.
Unsere Medien offenbaren uns seinen neuen Platz.
Es wurde als Freizeitpartner entdeckt, allerdings zu oft auch als Sportgerät missbraucht.
So wie seine Zahl wieder zunahm erhöhte sich auch die Zahl derer, die sich das Reiten oder Fahren und später auch den Besitz eines eigenen Pferdes leisten konnten. Vielen Landwirten rettete es dadurch auch die Existenz, denn seine Beliebtheit führte damit zur Entstehung vieler Pferdepensionen und Reiterhöfen.
Leider hat sich seither an den Lebensbedingungen unserer Equiden wenig oder gar nichts geändert.
Am Anfang der neunziger Jahre wurde kurzzeitig in der Fachpresse eine verstärkter Ruf nach artgerechter Tierhaltung in unserem Land hörbar.
Da fühlten sich selbst die renommiertesten Reitermagazine genötigt etwas zu diesem Thema zu veröffentlichen. Deren damaliger Marktführer druckte gar einen »Expertenbericht« von 5 bis 6 Seiten auf Hochglanz ab. Der »Experte« zog am Ende ein beeindruckendes Fazit, dessen Quintessenz folgendes aussagte: »Ein Boxenpferd lebt artgerecht, wenn es eine halbe Stunde am Tag gearbeitet wird«(Orginalzitat).
Der »Experte« war jedenfalls kein großer seiner Art.
Mir war nach dieser Lektüre schnell klar, dass er wie auch besagtes Magazin nichts anderes tat, als Lobbyarbeit für Besitzer teurer Boxenställe und Halter von Hochglanzpferden zu leisten. Diese könnten nämlich ihre Pferdegefängnisse dicht machen, wenn ruchbar würde, was artgerechte Haltung bei Pferden wirklich bedeutet.
Ein Pferd ist von Natur aus ein Fluchttier, ein Freilandbewohner und zudem ein Herdentier mit einem angeborenen Bedürfnis nach mindestens 11 bis 16 Stunden Bewegung täglich.
Das sagt eigentlich schon alles aber die Klienten des besagten Magazins verteidigen die Kerkerhaft ihrer Tiere mit den alten abgestandenen Argumenten. Demnach seien unsere modernen Edelrassen zu überzüchtet und empfindlich um auch bei schlechtem Wetter oder im Winter auf der Weide leben zu können
Ich habe einmal recherchiert wie es zu dieser Erkenntnis kommt.
Konzipiert ein Architekt oder Bauingenieur einen Stall, so besteht eine seiner Aufgaben darin das Raumvolumen so zu berechnen, dass die später darin gehaltenen Tiere in der Lage sind im Stehen mit ihrem Körper die Raumtemperatur in ein Behaglichkeitsniveau zu bringen und zu halten. Das wird beim Pferd im Allgemeinen bei etwa 6º C angenommen.
Inzwischen gibt es allerdings Menschen, denen dies nicht ausreicht, da sie es gut mit ihrem Tier meinen. Sie ermöglichen es ihrem Liebling es selbst wählen zu können, ob sie die frische Luft genießen, oder lieber drin Schutz suchen. Sie bauen einen Auslauf von 25 oder auch 50 qm und lassen die Tür dazwischen offen.
Nun ist es jedoch nicht mehr in der Lage mit seinem Körper die Raumtemperatur zu halten und der Auslauf nicht groß genug um ihm zu ermöglichen sich warm zu laufen.
Nehmen die Pferde in solchen Haltungsbedingungen jetzt Schaden, so steht das Fazit des Experiments sofort klar: Ein Pferd gehört bei schlechtem Wetter und im Winter in den Stall höchstens »Robustrassen« können da raus.
 Ein Blick in die Fachliteratur sagt uns dann, wie es früher gemacht wurde.
Ein Blick in die Fachliteratur sagt uns dann, wie es früher gemacht wurde.
Beim Bauern standen die Pferde im Stall und beim Militär auch, also wird das schon richtig sein.
Allerdings dort waren die Tiere den ganzen Tag über permanent eingesetzt. Sie arbeiteten enorm viel oder taten ihren harten Drill im Dienst eines Vaterlandes, von dessen Existenz sie nichts wussten.
Da waren sie dann auch froh, wenn sie einen trockenen Platz und ihr Futter hatten, selbst wenn sie nur eine Ständerhaltung kannten.
Jedoch - welcher berufstätiger Mensch ist heute in der Lage und verfügt über die Zeit seinen Freizeitpartner auch nur annähernd aus zulasten?
Ich kenne Reitervereine in denen jemand, der sein Pferd länger als 90 Minuten an einem Tag reitet als Tierquäler eingestuft wird und dies bei einem Tier, das die komplette restliche Zeit des Tages in einer, wie auch immer bemessenen Box zum Stehen verurteilt ist und dann noch (weil früher beim Militär so üblich) noch einen »Steh-Tag« pro Woche auf gebrummt bekommt also einen vollen Tag Kerkerhaft.
Was die Besitzer dann für Temperament, Kampfgeist oder gar Ehrgeiz halten ist schlichtweg Unausgeglichenheit und Ursache für einen großen Teil unserer jährlichen Unfallstatistik.
Die Versicherer täten sich einen Gefallen, würden sie Reitern, die ihre Tiere auf der Weide halten. Rabatte einräumen.
Zurück zu der ach so geringen Wetterhärte unserer »Edelrassen« .
Das Gegenteil trifft eher zu.
Bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts war das Pferd in Mitteleuropa das einzige Haustier, das nicht von Qualzucht gezeichnet war.
Der Grund dafür ist simpel. Man wollte seine Kraft und Ausdauer für sich nutzen beim Ackerbau, im Handel, in den Forsten und im Krieg.
Und wo fand bitteschön das alles statt? Immer im Freien und bei jedem Wetter. Deshalb hat man seine ihm von der Natur mit gegebene Wetterhärte nicht nur erhalten, sondern sogar gefördert. Natürlich wurde sie auch immer in der Selektion berücksichtigt und ein Pferd, das bei schlechtem Wetter nicht mehr einsetzbar war, wäre nie in die Zucht gekommen.
Aber dann kam die Zeit derer, die sich Pferde als Statussymbole hielten die Zeit der Neureichen. Jetzt begann sich in der Zucht auch immer mehr verbogener Zeitgeschmack durch zu setzen.
Nun streben »Pferdeliebhaber« in der Araberzucht die ach so hübschen Hechtköpfchen so extrem zu züchten, dass ihre Zuchtprodukte nicht mehr den Beinamen »Trinker der Lüfte« verdienen. Ihre Nasengänge sind jetzt teilweise so eng, dass sie höchstens das Attribut verdienen: »Schnüffler der Lüfte« .
Nun müssen Pferde über sich ergehen lassen, was es bei anderen Haustieren schon lange gibt. Ihr Habitus wird im Sinne eines oft fragwürdigen Zuchtziels manipuliert. Zudem wird geschminkt, Tasthaare werden geclippt, Ohren ausrasiert und auch »Schönheitsoperationen« gibt es zu beklagen. Die Schermaschine ist ebenfalls bereits fester Bestandteil im Alltag vieler, ohne dass auch nur eines der Tiere wirklich etwas davon hätte.
Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Nicht die normale Zucht (mit Ausnahme der Qualzuchterscheinungen), sondern unsere Manipulationen an den Tieren beeinträchtigen ihre Widerstansfähigkeit.
Ein nicht beeinträchtigtes Pferd hat nach oben, wie nach unten eine um 15ºC höhere Witterungstoleranz, wir können es auch Widerstandsfähigkeit nennen, als wir Menschen nebst unserer Kleidung.
In den USA gibt es einen Zuchtverband, der sich in den Kopf gesetzt hat Pferde mit extrem langem Schweif und extrem langen Mähnen zu züchten. Der längste Schweif soll 4,5m lang sein, die längste Mähne 2,5m.
So etwas hat nur Nachteile für das Tier. Die Konsequenzen für die Haltung? Sterile Boxen ohne Einstreu, denn die könnte sich ja im Langhaar festsetzen. Tägliches Shampoonieren und kunstvolles Einflechten von Mähne und Schweif. Vermutlich ist es auch nicht möglich solche Pferde ohne komplette Körperbekleidung und Beutel unterm Schweif ihr Kerkerdasein fristen zu lassen. Normales Reiten oder Fahren mit offenem Haar ist ebenfalls undenkbar und bei der ein geflochtenen Mähne ein gewaltiger Hitzestau im Halsbereich sicher.
So werden die armen Opfer dieser »Liebhaber« nicht etwa auf dem Reitplatz oder einem Führring vorgestellt, sondern mit wehendem Haar im sie lesen richtig Windkanal!!!.
Für mich ist dies Perversion in Reinkultur.
Ersparen wir uns das alles und vor allem, ersparen wir es unseren Pferden.
Gehen wir von den Bedürfnissen aus, die diese Tiere von Natur aus haben.
Keines unserer anderen Haustiere hat auch nur annähernd ein so hohes Bewegungsbedürfnis wie das Pferd. So gehört zu den Prämissen eines Pferdes, dass es seine Gliedmaßen in ausreichendem Maß benutzen will, wie auch ein Vogel seine Flügel dem Zweck gemäß einsetzen möchte. Sind in seinem Leben diese u. a. Bedürfnisse erfüllt, so ist für das Tier die Welt in Ordnung, auch wenn sich ein Zaun außen herum befindet.
Das ist aber bei einem Pferd in reiner Boxenhaltung nicht gegeben. Das »Zimmerchen« kann noch so schön sein und liebevoll hergerichtet sein es entspricht unseren und nicht seinen Bedürfnissen.
Ich kenne Tierschützer, die auf Demo´s gegen Käfighaltung bei Geflügel protestieren (übrigens mit Recht) und gehen dann anschließend auf die Rennbahn oder in ihren eigenen Stall um nach ihrem Liebling zu sehen, der dort ein genauso beklagenswertes Dasein fristet.
Seit vielen Jahren kommt bei mir kein Pferd mehr in den festen Stall. Auch meine Prämissen haben sich geändert.
Seit zwei Jahrzehnten stelle ich meine Fragen anders.
Früher: Was muss ich tun, um dies oder jenes mit dem Tier machen zu können?
Heute:Ist es einfach keine Frage mehr für mich. Ich verkneife mir jede Nutzung, die mich daran
hindern könnte mein Pferd artgerecht zu
halten.
Es ist fragwürdig, wenn nicht gefährlich, ein Pferd mit Stolleneisen auf einer Weide in der Herde zu halten. Also unterbleiben für mich Turniere, die mich dazu zwängen, mein Tier so zu beschlagen.
Nun gibt es nicht wenige Reiter, die der Meinung sind, Pferde müssten immer beschlagen sein. Besonders Schmiede höre ich das sagen.
Na klar, die verdienen ja am Beschlag.
Nun muss ich zugeben, dass eben wegen dieser Auffassung in den reicheren Ländern deshalb seit Jahrzehnten in der Zucht viel zu wenig Augenmerk auf die Hufqualität gerichtet wurde.
Trotzdem gibt es nur ganz selten Pferde, die wirklich solch schlechte Hufveranlagung haben, dass sie deshalb einen permanenten Hufschutz benötigten.
Liebe Pferdeliebhaber, die ihr gewaltige Summen ausgebt, damit eurem Tier ein Unterwasserlaufband und ein Solarium zugänglich wird, (das Solarium meines tierischen Freundes umfasst mehrere Hektar) gebt lieber Geld aus für eine gute Hufpflege. Sollte im Falle einer entsprechenden Nutzung ein Hufschutz nötig sein, dann gibt es inzwischen auch recht guten temporären Hufschutz.
Wenn ihr euerTier aber nicht nutzt, dann lasst es sich und seinen Kumpels.
Jedes Pferd gleich welcher Rasse hat die Grundfähigkeit im Freien zu leben. Selbst solche, die lange Zeit in Boxen gehalten wurden, lassen sich schnell wieder an ein Leben auf der Weide gewöhnen.
Geht die Anpassung überlegt vonstatten, freut sich auch ein altes Boxenpferd über die neu gewonnene Bewegungsfreiheit.
Es ist ein Irrtum anzunehmen, es sei schwierig ein Pferd in eine Herde zu geben, die schon längere Zeit zusammen steht und nur im Frühjahr möglich.
Prinzipiell ist es zu jeder Zeit möglich ein oder mehrere Tiere in eine Herde zu geben. Allerdings haben es Gruppen naturgemäß etwas leichter. Man sollte nur einige Dinge beachten.
Die Koppel sollte groß genug sein, damit sich die einzelnen Herdenmitglieder aus dem Weg gehen können, um sich anschließend einander annähern zu können.
Die Weideabgrenzung sollte keine spitzen Winkel oder Sackgassen aufweisen, in denen sich neue Tiere gewissermaßen »verfangen« könnten.
Unterstände sollten immer auf einer kompletten langen Seite geöffnet sein, damit nicht der gleiche Effekt entsteht.
Die Tiere sollten keine Halfter tragen. Diese bilden eine Gefahr für das Tier.
Bei Pferden, die lange in Boxen gelebt haben kann es durchaus sein, dass sie eine Weile brauchen die Riten zu erlernen mit denen sich das Herdenleben regelt. Sie müssen gewissermaßen erst sozialisiert werden. Deshalb sollte man diese eine Weile beobachten.
Bei extremer Witterung kann man sie ja auch für kurze Zeit in einem Reservequartier unterbringen. Erfahrungsgemäß ist das in unseren Breiten kaum nötig.
Abzulehnen ist allerdings die Herdenhaltung von Pferden, die mit scharfem Beschlag versehen sind. Erhöhte Aufwendungen, z. B. Für schraubbare Stollen, werden mehr als ausgeglichen durch entfallende Tierarztkosten.

Generationen übergreifendes Familienleben in einer Freilandhaltung erlernen Jungtiere am besten soziale Kompetenz
Wie ist es nun bestellt mit der Frage der Geschlechter?
Vor etlichen Jahren machte ein Fall in der regionalen Presse Sachsens von sich reden, den Tierschutzorganisationen öffentlich angeprangert hatten.
Ein älterer Herr, laut Leumund Vertreter der klassischen Hohen Schule, hielt 12 Lipizzanerhengste ausschließlich in Boxen von Standartgröße. Auf Umstände und den personellen Hintergrund möchte ich hier nicht weiter eingehen, sondern nur darauf wie sich die Angelegenheit für die Tiere darstellte.
Sie standen tagaus, tagein in ihren Boxen, wurden nicht einmal geritten und einen Koppelgang lernten sie ebenfalls nicht kennen.
Die Forderungen der Tierschutzorganisationen, über die Presse dargelegt, wurden lebhaft debattiert und ein Tauziehen zwischen ämtern und Organisationen beschäftigte für einige Zeit die Gemüter.
Der Besitzer der Tiere (Eigentum ist ja heilig) beharrte auf seiner Haltungsform und so ging das alles aus wie das Hornberger Schießen. Sein Argument, das seine Gegner nicht entkräften konnten war: »Hengste kann man nicht auf der Koppel halten. Wenn sie eine Stute sehen, dann hält sie kein Zaun auf. Hengste in der Gruppe zu halten gehe schon gar nicht. Die brächten sich gegenseitig um«.
Er hält seine Hengste noch heute so.
Ein Jahrzehnt nach der in Vergessenheit geratenen Debatte hatte ich auf dem benachbarten Grundstück zu tun und mehrere Monate lang besagten Hof nebst angrenzendem Weideland ganztägig direkt in meinem Blickfeld.
In dieser Zeit sah ich maximal zwei bis dreimal jeweils ein Pferd in einem Roundpen mit ca. 15m Durchmesser. Einmal in der Woche, meist am Samstag und selbstverständlich nur bei gutem Wetter, durfte jeder der Hengste einzeln für eine volle Viertelstunde!!! auf eine Koppel. Dabei achteten mit Peitschen bewaffnete Mädels darauf, dass sich das jeweilige Tier nicht allzu sehr dem, zugegebenermaßen nicht sehr Vertrauen erweckenden Zaun näherte.
15 Minuten Auslauf pro Woche!!!
Hengst zu sein bedeutet in Deutschland nicht nur an dieser Stelle ein bedauernswertes Dasein.
Für Hengstbesitzer, die derartiges ablehnen gibt es zwei Möglichkeiten: das Tier abschaffen oder recherchieren, wie man es anders machen könnte. Dies habe ich zur besagten Zeit durch zwei Fragen, die ich an vier Fachzeitschriften richtete, zu ermitteln versucht.
- Was muss ich bedenken, wenn ich Hengste in einer Herde auf der Weide halten möchte?
- Wie schaffe ich eine reibungslose Wiederintegration eines Tieres in die Hengstgruppe, wenn dieser seine Arbeit zur Reproduktion in einer Stutenherde getan hat?
Darauf warte ich nun schon seit sieben Jahren.
Allerdings muss ich bekennen, dass mich dies nicht wirklich überrascht. Es ist in Deutschland halt gängige Lehrmeinung, es sei schlicht nicht möglich Hengste auf der Weide zu halten und zusammen schon gar nicht. Deshalb gibt es eine derartige Diskussion überhaupt nicht.
Nun gehöre ich nicht zu den Menschen, die überkommene Lehrmeinungen einfach hinnehmen, wenn sie nicht gefallen. Aber ebenso lehne ich sie auch nicht einfach ab. Ich setze mich mit ihnen auseinander, denn Konventionen hatten ja alle mal eine handfeste Ursache und dementsprechend eine Daseinsberechtigung. Es gilt heraus zu finden, ob diese noch existiert.
Um es kurz zu machen, ich habe die Antwort gefunden und schon Jahre vorher erfolgreich in die Praxis umgesetzt.
Bei uns lebten auf 26ha Weide bis zu 36 Pferde in je einer männlichen und einer weiblichen Herde, wobei die kleinste der sieben Wechselkoppeln allein etwa 2,5ha umfasste.
Die männliche Gruppe bestand aus Wallachen und bis zu 7 erwachsenen Hengsten, von denen mindestens fünf bereits gedeckt hatten. Auch sie lebten ganzjährig auf der Weide, von den Stuten oft nur getrennt durch einen Weg und zwei Zäune.
Die Antworten hat mir die Natur gegeben.
Warum also könnten Hengste nicht in Freilandhaltung leben?
Weil sie sich als Rivalen sehen? Stimmt nur bedingt. Wenn es um Stuten geht sind sie Konkurrenten, doch untereinander sind sie Kumpels wie in der Natur auch im »Club lediger Herren«.
Hengste würden durch jeden Zaun gehen, wenn sie eine Stute sähen?
Das kommt allerdings wirklich auf den Zaun an. Sicherheit gibt da eine einfache Litze nicht.
Der Gesetzgeber will ohnehin nur einen Massivzaun als sicher anerkennen. Vom materiell unverhältnismäßigen Aufwand einmal abgesehen verspricht er bei Pferden, ganz besonders wenn sie im Springen trainiert sind, wenig Erfolg. Feste Stangen und Bohlen sind schließlich bestens für einen sicheren Sprung taxierbar. Das ist bei Litzen und Elektrobändern ganz anders. Sie lassen sich schwer taxieren, besonders wenn der Wind sie bewegt. Solche Hürden nimmt kein Pferd freiwillig.
Dieser Widerwille verstärkt sich immens, wenn dieser Zaun mit kräftigen Elektroimpulsen Respekt erzeugt.
Für Hengst-koppeln empfehle ich eine Zaunhöhe von 1,5m, die stromführenden Elemente in solchen Abständen, dass keines der Tiere mit seinem Kopf zwischen ihnen hindurch passt.
Seit 1994 lebten bei mir Hengste auf der Weide, und nur in einem Fall zeigte sich im ersten Jahr, dass ein einfacher Zaun als Hindernis zwischen den Geschlechtern nicht ausreicht. Eine rossige Stute hatte es zu dem Hengst gezogen, und nach der ersten Kontaktaufnahme, in ihrer Koketterie die Absperrung wohl vergessend, diese mit der Vorderhand stampfend zerlegt. Die Herden wieder zu sortieren dauerte etwa eine Stunde, die Zaunreparatur wesentlich länger.
Seitdem waren all unsere Weiden so gestaltet, dass ein direkter Kontakt über die Zäune hinweg nicht mehr möglich waren. Reiter auf den Wegen um und zwischen den Koppeln waren zudem verpflichtet, Berührungen ihres Reittieres mit den Weidebewohnern zu unterbinden.
Das war das letzte mal gewesen, dass sich ein Problem aus der Hengsthaltung auf der Weide ergeben hatte.
Bliebe also nur noch die Frage, was mache ich mit einem Hengst nach seinem dreimonatigen Deckeinsatz?
Diese Frage stellte sich mir 1999, als mein Pintohengst das Frühjahr auf einer meiner Weiden mit sechs dafür vorgesehenen Stuten verbracht hatte.
Fachliteratur? Fehlanzeige - da wird diese Frage nicht einmal erwähnt.
Mein Ratgeber war mal wieder die Natur selbst.
Für jeden Althengst kommt auch mal eine Ablösung. Sie kommt wahrscheinlich mit Verletzungen, doch sie ist nicht zwangsläufig tödlich. Das ist wohl eher selten der Fall. Um zu überleben muss das Tier einerseits seine Verletzungen auskurieren und andererseits baldigst wieder einen Club lediger Herren finden.
Sein Chancen, allein zu überleben, sind auf Grund seiner Erfahrung sicher größer als bei einem gerade erst geschlechtsreif gewordenen Junghengst, der eben erst die mütterliche Herde verlassen hat. Trotzdem hat er nur wenige Tage, eine entsprechende Gemeinschaft zu finden und die finden zu wollen, ist eben auch in seinen Instinkten verankert.
So wächst sein Drang nach Anschluss.
Diese Probleme hatte unser Hengst sicher nicht, aber das wusste er nicht. Hätte ich ihn allerdings direkt von den Stuten weg in die männliche Herde gestellt, dann wären die Folgen unabsehbar gewesen.
Der ihm anhaftende Stutengeruch hätte sofort die anderen Hengste in Wallung gebracht und er selbst mit seinem noch hoch gepuschten Selbstbewusstsein hätte sicher auch noch die Offensive gesucht.
So habe ich ihm mehrere Wochen Einsamkeit verordnet. Er sollte sich nach der Gemeinschaft sehnen und Regen den letzten Rest der Gerüche seiner amourösen Begegnungen tilgen.
Danach war alles ein Kinderspiel und wohl mehr von Wiedersehensfreude gekennzeichnet. Nach fünf Minuten war alles wieder so, als wäre er nie weg gewesen.
Wer so etwas tut, der darf allerdings nicht erwarten, dass es unter den Hengsten vollkommen ohne Blessuren abgeht. Wenn man sich aber fragt, was dem Pferd lieber ist, immer makellos mit glänzendem Kurzfell in einer Box allein stehend sein Dasein zu fristen, oder ein paar Schrammen oder Beulen in Kauf nehmend mit Artgenossen über Wiesen zu toben, wird man schnell die Antwort wissen -
welches das glücklichere Tier ist. Für das Portemonnaie lohnt es sich ebenfalls. In einem Jahrzehnt Weidehaltung gab es bei uns keine Kolik, keine Hufrehe, keine Infektionskrankheiten und, von wenigen kleineren Verletzungen wie etwa einem eingetretenen Stein einmal abgesehen, keine Tierarztkosten, außer denen für Wurmkuren und Impfungen.
R.K.

Frieden auf einer Koppel mit 15 männlichen Pferden, wovon sieben erwachsene Hengste waren.
…zu Grabe getragen. (2009)
Ursprünglich standen den Ausstellern drei Hallen für die Präsentation ihrer Angebote zur Verfügung. Davon ist 2009 eine halbe Halle übrig geblieben.
Bis vor zwei Jahren gab es auch noch eine zweite Show-Arena, auf der u.a. ein Westernturnier statt fand, wonach viele Zuschauer auch in diesem Jahr vergebens gesucht hatten. Zur Erklärung sei gesagt, dass von der Messeleitung zu dessen Durchführung eine entsprechende Finanzierung über Sponsoren gefordert worden war. Die Szene der Westernturnierorganisatoren wiesen diese auch nach (eine Brauerei und eine Bank), was jedoch offensichtlich an den Exklusivverträgen mit den aktuellen Sponsoren des klassischen Turniers der Spring- und Dressurreiter, nämlich einer bekannten Brauerei und einer lokalen Sparkasse scheiterte. Dies wurde zwar nicht bei den Gesprächen als offizielle Begründung angegeben, aber da dabei immer andere fadenscheinige Ablehnungsgründe genannt wurden, bleibt kaum ein anderer Schluss. Da hat man sie wieder dort wo man die Westernreitszene gern hat, nämlich draußen.
Die Antwort auf die Frage, ob denn nun eine Messe die Funktion hat Sponsoren darzustellen, oder verschiedene Formen der Nutzung von Pferden in unserer Region, lasse ich an dieser Stelle erst einmal unbeantwortet.
Hier möchte ich mich dem widmen, was die meisten der Aussteller nach Leipzig geführt hatte.
Die Messe selbst zeigte positive, wie negative Bilder. Vor allem der Reitunterricht, den Christine Stückelberger, Olympiasiegerin in der Dressur 1976, zwei Reiterinnen aus dem Landesgestüt über mehrere Tage gab, war mehr als sehenswert und lehrreich. Dies auch für Leute, die wie ich schon über vier Jahrzehnte mit Pferden zu tun hatten. In der restlichen Zeit stand sie am Stand der »Gesellschaft für den Erhalt und Förderung der klassischen Reitkultur Xenophon« Rede und Antwort.
Verschiedene Reitweisen und verschiedene Pferderassen wurden ebenfalls in dem sehr kleinen Showring der Halle 3 vorgestellt.
Hier zeigte sich das eigentliche Desaster dieser Messe. Die Akteure auf diesem Platz hatten keinerlei Möglichkeit ihre Pferde vor ihrer Vorführung abzureiten. Dieses Manko wurde bereits im vergangenen Jahr in der Auswertung bemängelt, mit dem Ergebnis, dass die Verhältnisse durch eine veränderte Anordnung des Ringes in diesem Jahr noch schlechter waren. Zwei Reiterinnen, die dies ihren Pferden nicht zumuten wollten, ritten ihre Tiere auf einer Wiese außerhalb des Messegeländes ab, was weder versicherungstechnisch noch physisch als zumutbar angesehen werden kann. Man sollte im Grunde annehmen können, dass ein Aussteller, der nicht wenig dafür bezahlt seine Tiere vorstellen zu können, erwarten kann akzeptable Bedingungen vorzufinden. Dies war in Leipzig, der teuersten der in Frage kommenden Pferdemessen, nicht gegeben.
Noch weniger war zu verantworten, dass die Akteure inmitten des doch zahlreichen Publikums auf ihren Auftritt warten mussten. Wenn man bedenkt, dass über die Hälfte der vorgestellten Tiere Hengste waren, ist dies um so unverständlicher. Ich nenne hier nur einen Teil derer Rassen: PRE (Spanisches Vollblut), Sire-Horse (Stockmaß 1,86m), Andalusier, Friese, Paso Peruano…
Mit einem Paso-Hengst wäre es auch fast zum Eklat gekommen, als er beim Passieren eines vermeintlichen Rivalen im Ausweichmanöver nahe daran war die Ausstellungsstücke der Barockreiter zu zerstören.
Zudem hatte die Messeleitung noch mit dem rutschfesten Bodenbelag so gegeizt, dass am Rande der Gänge Streifen von bis zu einem Meter Breite glatter Stahlboden zu Rutschpartien einlud. Zwei Stürze von Pferden (man bedenke im Publikumsverkehr) und einige weitere, nicht ungefährliche Situationen waren die voraussehbaren Folgen.
Dies schien die Messeleitung aber auch nicht besonders zu berühren, war doch hier ihr Hauptaugenmerk auf das Turniergeschehen mit der Weltelite vor allem im Spring- und Dressurreiten gerichtet, das in der großen Arena stattfand.
Der Sport dominierte auch den Charakter der viertägigen Veranstaltung. Dabei konnten wir das untrügerische Gefühl erleben, uns in dieser Messe in einer Zweiklassengesellschaft zu befinden.
Im Bereich der alternativen Reitweisen und der Freizeitsportler, die immerhin nach vorsichtigen Schätzungen über 80% der Pferdenutzer ausmachen, herrschte hoffnungslose Enge mit inakzeptablen Bedingungen.
Der »Elite« des Reitsports stand allein für die Unterbringung ihrer Tiere eine halbe Halle zur Verfügung. Dazu standen drei große Abreitplätze zu ihrer alleinigen Verfügung. Sicherheitskräfte sorgten dafür, dass sich niemand von den »Gewöhnlichen« mit oder ohne Pferd in diesen Bereich einschleichen konnte.
Wer allerdings glaubte sich bei den »Großen« etwas abschauen zu können wurde böse enttäuscht.
Von unserem Stand aus konnten wir das Treiben auf zweien der Abreitplätze über alle vier Tage verfolgen und was wir zu sehen bekamen war eines Schmerzensgeldes für die Betrachter würdig. Bisher hatte ich geglaubt, dass die berüchtigte »Rollkur« eine Entgleisung einzelner vom Ehrgeiz zerfressener Reiter der zweiten Garnitur sei. Hier wurde nicht nur ich eines Besseren, oder korrekt ausgedrückt Schlechteren belehrt.
Wir wurden unfreiwillige Zeugen einer Inflation und des Missbrauchs des Schlaufzügels. Eingerollte Pferde mit dem Kopf weit hinter der Senkrechten, der Nase an der Brust waren die Regel.
Ich verzichte hier bewusst auf ein Foto, um dem gängigen Vorwurf zu entgehen eine Momentaufnahme auszuweiden. Wer Bilder davon sehen möchte, dem empfehle ich sich im Internet unter dem Stichwort »Rollkur-Hyperflexion« bei YouTube einzuklicken. Hier bekommt er das Dilemma ganze 6 Minuten zum »genießen« serviert.
Es waren sowohl bei den Spring-, als auch den Dressurreitern ständig präsente Bilder. Wie mir Frau Stückelberger bestätigte, sind diese inzwischen im gesamten Hochleistungssport üblich geworden und nicht nur in Leipzig zu sehen. Sie berichtete mir, dass sie sogar eine Dressurreiterin aus unserer berühmten Nationalmannschaft dabei ertappte, dass sie den Schlaufzügel nicht wie üblich durch den Trensenring, sondern durch die Ringe am unteren Ende der Kandare gezogen hatte. Zwanglosigkeit kann man das alles nun wirklich nicht mehr nennen Brachialgewalt ist das wohl einzig wahre Wort dafür.
Hyperflexion ist allerdings auch ohne Schlaufzügel möglich, sofern der Reiter über die nötige Kraft verfügt und ist dann nicht weniger quälerisch und schädlich. Die unangenehmsten Bilder sah ich bei der Reiterin, die ich als die deutsch-amerikanische Antwort auf Hugo Simon sehe. Bemerkenswert ist dabei, dass sie vor den letzten olympischen Spielen in einem Interview stolz darüber berichtete, sie mache auch Ausgleichssport und u.a. Kraftsport, denn im Parcours hätte sie in jeder Hand 20kg zu halten. Sind das die Vorbilder für unseren Reiternachwuchs?
Die Worte Horsemanship oder gar Reitkunst kann ich beim besten Willen nicht mit diesen Reitern in Zusammenhang bringen.
Ob mit oder ohne Schlaufzügel ist die Rollkur eine Tortur fürs Pferd, egal ob der Reiter nun im klassischen oder dem Westernstil reitet. Dies sage ich bewusst, denn die beiden Damen, die im kleinen Showring den Reitstil der nordamerikanischen Cowboys zeigen wollten, waren da kaum besser. Allerdings waren da die Nasen ihrer Pferde nicht auf die Brust gezogen, sondern näherten sich, Staubsaugern ähnlich, dem Geläuf. Die Köpfe zeigten teilweise bis 45 Grad nach hinten und der Widerrist markierte dabei meist den höchsten Punkt. Manchmal war allerdings die Kruppe noch höher. Das steht auch in ihrem Regelwerk anders.
Sollte es reine Unwissenheit sein, die ahnungslose Reiter so vorgehen lässt?
In den letzten 15 Jahren habe ich bei Seminaren mit mindestens 700 Reitern unterschiedlichen Ausbildungsstandes beim Thema Dressur und deren Sinn einen einfachen Test gemacht. Von allen Teilnehmern waren nur zwei in der Lage in einen Pferdeumriss exakt den Verlauf der Wirbelsäule einzutragen. Bei denen, die dies nicht konnten waren auch Reiter dabei die, bevor sie zu mir kamen, bereits etliche Turnier bis Klasse M bestritten hatten. Natürlich konnten sie dann auch nicht wissen, welche Konsequenzen durch die Lage, die Verspannung und die dazugehörige Bemuskelung für die Ausbildung und das Reiten eines Pferdes verbunden sind. Ein Armutszeugnis für ihre ehemaligen Ausbilder und Trainer.
Unwissenheit oder Gleichgültigkeit gegenüber der Kreatur?
Diese Unwissenheit will ich unseren »Elite« - Reitern ja gar nicht unterstellen. Wissen sie allerdings was sie damit tun, so ist es noch schlimmer.
Warum machen diese Reiter dann diesen ganzen Rollkurunfug? Weil es die Richter so sehen wollen (höre ich immer als Gegenargument), oder weil Grad Prix - Pferde nicht anders zu handeln seien.
Warum lassen Richter das nicht nur zu, sondern verteidigen es noch? An unserem Stand erschien eine frustrierte Dame, die sich bei uns über die Antwort eines am Abreitplatz stehenden beaufsichtigenden Richter erregte, nachdem sie diesen gebeten hatte, doch endlich diesem Treiben ein Ende zu setzen. Nach Aussage dieser Messebesucherin war die Antwort: »Halten sie den Mund, sonst bekommen sie Platzverbot.«
Warum handeln Richter so? Weil es die Funktionäre so wollen?
Warum wollen die Funktionäre es so? Weil es ums Geschäft geht?
Warum läuft das Geschäft so?
Weil schlechte Moderatoren dem Publikum auch schlechtes Reiten noch für hohe Reitkunst verkaufen, Taktunreinheiten in den Grundgangarten, hervorgerufen durch Verspannung geflissentlich übersehen und alles Spektakuläre bejubeln, alle Indizien für das Unwohlsein des Tieres als Temperamentsäußerungen interpretierend.
In der LPO (Leistungsprüfungsordnung) sind, aus gutem Grund, Schlaufzügel in der Prüfung nicht erlaubt. Warum sind diese dann auf dem Abreitplatz zugelassen?
Weil das Pferd nichts ist als ein Sportgerät?
Wenn dem so ist, warum erlaubt man dann nicht auch gleich wieder das Barren?
Barren ist für´s Pferd schmerzhaft die Rollkur schmerzhaft und gesundheitsschädlich.
Der Zweck heiligt auch in der Reiterei nicht die Mittel.
Streben wir beim Reiten eine Kunstform an oder einen Kampfsport?
Die Messeleitung hat sich in diesem Jahr einmal mehr auf die Schulter geklopft und den Rekord in den Besucherzahlen bejubelt.
Auch wenn sich mancher dies wünschen möchte der IQ eines Menschen ist nicht an seinem Kontostand ablesbar.
Finanzieller Erfolg kann, wie in diesen Messehallen bewiesen, nicht als Qualitätsmerkmal herangezogen werden. Auch bedeutet Popularität noch lange nicht Können, Intelligenz, oder gar positive charakterliche Eigenschaften.
Sollten jedenfalls die Verhältnisse in Leipzig so bleiben, dann empfehle ich der Messeleitung im nächsten Jahr der Veranstaltung den zutreffenden Namen zu geben »Sportgerät Pferd.«
Bei dem, was wir in dieser Stadt während dieser vier Tage zu sehen bekommen hatten, bleibt nur ein Schluss:
Die HDV 12 und die ethischen Grundsätze der FN sind längst zu Grabe gertragen.
Reinhart Kraft
Nachtrag:
Inzwischen wurden die Beiträge »Rollkur Hyperflexion« 1 und 2 bei You Tube aus dem Netz genommen wegen »urheberrechtlicher Gründe.«
Die Lobby der VIP´s hat wohl wieder einmal zugeschlagen. Hätten sie das auch getan, wenn es sich um einen Lobhudelbeitrag der üblichen Schmeichler gehandelt hätte?
Sind die »Elite« Reiter keine Personen der öffentlichkeit?
Trotzdem sind noch genügend Bilder bei YouTube veröffentlicht, mit denen die »Rollkur« gezeigt wird, wenn auch nicht von der »Partner Pferd« 2009, und wer es möchte kann sich das zweifelhafte »Vergnügen« gönnen.
Dürfen in unserem Land der Pressefreiheit nur vom Messebüro abgesegnete Hymnen legitimierter Schönfärber veröffentlicht werden?
Doch die anderen Stimmen werden trotzdem immer lauter - meine auch.
Reinhart Kraft
"Pferde in Sachsen und Thüringen" traute sich aus, wie geäußert "politischen Gründen", nicht diesen Artikel zu drucken. ähnlich reagierten auch andere Fachorgane. Er erschien in sehr entschärfter Form in der zweiten Ausgabe der "Piaffe" 2009 als Leserbrief.
Reiten wir mal durchs Döbelner Land… (2006)
Als ich von Reitern aus diesem Gebiet am Anfang des Jahres gebeten wurde das ihnen von den zuständigen Behörden ausgewiesene Reitwegenetz zu testen, stimmte ich fröhlich zu, nicht wissend, was da auf mich zukommen sollte.
Um etwas testen zu können benötigt man allerdings erst einmal definierte Beurteilungskriterien. Ein Landwirt oder ein Forstbeamter beurteilt einen Weg nach der Nutzbarkeit mit seinen Fahrzeugen. So liegt es auch in der Natur der Dinge, daß ein Reiter ihn danach einschätzt, wie sich eine Nutzung des jeweiligen Weges auf den Organismus seines Reittieres auswirkt, d. h. für ihn kann nur der Tierschutzgedanke ein Leitmotiv darstellen.
So entstand in der Zusammenarbeit mehrerer Vertreter verschiedener Reitverbände ein Benotungssystem von 1 bis 6.
Mit Note 1 sind dabei naturbelassene Wiesen-, Sand-, oder Waldwege zu benoten, die unabhängig vom Hufbeschlag des Pferdes in allen Gangarten begehbar sind. Dem gegenüber sind z.B. Wege mit Grobschotter oder Splitt wegen der negativen Auswirkungen auf die Beine unserer Pferde mit der Note 6 als ungeeignet, auch für beschlagene Tiere zu eliminieren.
Vor meiner ersten Testaktion Mitte August 2006 zeigte allerdings bereits das Kartenstudium, dass im Landkreis Döbeln noch eine zusätzlich Kategorie herangezogen werden muss, nämlich die Note 0. Diese ist in dem Fall allerdings nicht besser als 1, sonder kennzeichnet Strecken, deren Ausweisung als Reitwege den gesetzlichen Vorgaben widerspricht, denn öffentliche Straßen, und öffentliche Wege können keine Reitwege sein. Diese stehen allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung.
Wer im Kreis Döbeln mit dem Pferd unterwegs ist, um die Gegend zu erleben, wird ihn zumindest mit dem Pferd nie wieder besuchen.
Die von uns getesteten, von den Kreisämtern ausgewiesenen und gekennzeichneten Wegstrecken setzen sich wie folgt zusammen:
- Fernreitwegenetz 55,9 Kilometer
- Regionalreitwegenetz 18,3 Kilometer
Nun ist bekannt, dass dieser von allen sächsischen Landkreisen dem geringsten prozentualen Anteil von Wald an seiner Gesamtfläche besitzt. Bedenkt man, dass die Notwendigkeit Reitwege auszuweisen erst dadurch entstand, dass es in Sachsen ein Waldgesetz gibt, das es uns verbietet, im Wald zu reiten, außer auf speziell dafür vorgesehenen Reitwegen, dann ist im Kreis Döbeln schon auffällig, dass es hier nicht einen einzigen Meter Reitweg durch einen Wald gibt.
Schade ist dies schon, denn wo es in der Region Döbeln Wald gibt ist er Teil einer wunderschönen touristisch attraktiven Landschaft, durch das Muldental geprägt, mit vielen historischen Sehenswürdigkeiten, die zu sehen nun wohl nur den Nutzern technischer Fortbewegungsmittel vorbehalten bleiben dürften.
Alles in Allem stehen den Reitern im Kreis Döbeln 74,2 Kilometer Reitwege zur Verfügung.
Das klingt, als hätten die ämter ihre Hausaufgaben gemacht, ist doch das Widmen von Reitwegen letzt endlich Kreissache.
Plan erfüllt nach oben weitergeben Lob einheimsen.
Die Methode ist hinlänglich bekannt. 40 Jahre »Planerfüllung« haben die DDR trotzdem nicht retten können.
Nun sind vom Land vorgegeben für Reitwege folgende Attribute in Anwendung zu bringen: » geeignet«, »ausreichend« und »zusammenhängend« .
Zusammenhängend sind die vorgegebenen Reitwege allemal und führen sie auch nicht gerade durch die attraktivsten Gebiete des Kreises, so erreicht man doch über sie den einen oder anderen Reiterhof, ab und zu auch mal eine nette Gaststätte.
Das Wort ausreichend sehe ich allerdings als nicht erfüllt an, denn die Gesamtstrecke ist, gemessen an der Anzahl der vor Ort lebenden Pferde zu gering. Da besteht erheblicher Erweiterungsbedarf.
Dies wird noch prekärer, wenn man sich das ausgewiesene Reitwegenetz genauer ansieht.
Dazu nenne ich drei Zahlen:
- 75,2 Kilometer ausgewiesen und gekennzeichnet
- davon 5,6 Kilometer öffentlicher Weg
- und 57,9 Kilometer öffentliche Straße
Wirklich als echte Reitwege bezeichnet werden können nur die kläglichen Reste von 11,7 Kilometer, die in kleinen Stücken über den ganzen Landkreis verteilt sind. Nur 5,9 Kilometer davon verdienen die Noten 1 3 und können allen Ernstes von Reitern genutzt werden.
Die ideenreichen Autoren dieses Reitwegenetzes sollte man in Gremien, welche Radwege planen, delegieren. Dann würden vielleicht unsere Autobahnen als Radwege gewidmet werden.
Der ganze Kreis Döbeln ist für Pferdeliebhaber jedenfalls so unattraktiv, dass er von ihnen gemieden werden wird.
Dieses Reitwegesystem stellt nichts anderes dar, als ein Patjomkinsches Dorf.
Sollten für dieses allerdings Gelder geflossen sein, bzw. von Reitern eingefordert werden, dann gebe ich diesem Kind der Ignoranz seinen wirklichen Namen BETRUG.
Reinhart Kraft
Der Artikel erschien in Auszügen im Herbst 2006 in den beiden wichtigsten Kreiszeitungen im Kreis Döbeln und vollständig in der Januarausgabe 2007 von "Pferde in Sachsen und Thüringen". Das Bewertungssystem wurde von der obersten sächsischen Forstbehörde 2006 anerkannt und es gab bereits 2007 Anfragen von Reitern anderer Bundesländer, ob sie dies verwenden dürften. Dies habe ich selbstverständlich gebilligt.